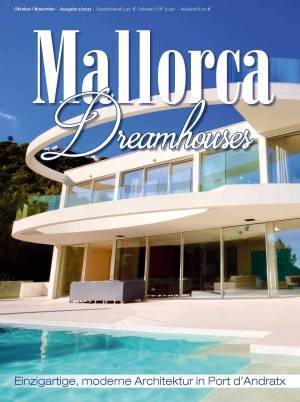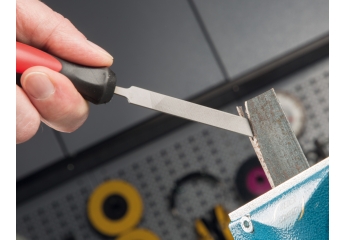Marke: my-PV
Energie aus Balkonkraftwerken selber nutzen, statt verschenken! Wie Balkonkraftwerke effizienter genutzt werden können

Balkonkraftwerke erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Die Gründe dafür sind vielfältig: Eine gewisse Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen, immer günstigere Komponenten und die einfache Installation. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass bei einer Wechselrichterleistung von 800 W keine Genehmigung durch den Netzbetreiber erforderlich ist. Dennoch bleibt oft unklar, wie viel Energie tatsächlich genutzt werden kann und welches Potenzial diese Kleinstanlagen bieten.
Viele Balkonkraftanlagen werden im Wohnungsbau verwendet. Zu Zeiten, da der Stromverbrauch am höchsten ist, in den Morgenstunden und am Abend, ist der Ertrag vergleichsweise gering. Im Verlauf des Tages, wo der Stromertrag am höchsten ist, bleibt die Energie oft ungenutzt und geht unvergütet ins öffentliche Netz. Das erfreut zwar den Stromanbieter, bringt dem Verbraucher aber nichts. Hier könnte deutlich mehr aus der selbsterzeugten Photovoltaikenergie gemacht werden.
Um dieses Potenzial anschaulich abzubilden haben wir in diesem Artikel anhand von vier Beispielszenarien Effizienz und Eigenverbrauch von Balkonkraftwerken untersucht. Wir gehen von einem 2-Personen-Haushalt in Konstanz (Baden-Württemberg) aus, in dem ein 120 l Warmwasserspeicher mit einem 3 kW Heizstab verbaut ist. Bei der Berechnung gehen wir von einem täglichen Warmwasserverbrauch von insgesamt 100 l aus. Für den Stromverbrauch wird ein Lastprofil mit stündlichen Werten für ein Paar im Alter von 30 bis 65 Jahren, beide außer Haus berufstätig, verwendet. Der Haushalt verbraucht im Jahr 2.126 kWh Strom für die herkömmlichen Hausverbraucher, ohne Warmwasserbereitung. Für die Warmwasserbereitung werden zusätzlich 2.287 kWh/Jahr angenommen.
Auf diesen Annahmen wurden einige Varianten mit einem Balkonkraftwerk, mit den für Deutschland zugelassenen Parametern berechnet. Es wird ein 800 W Wechselrichter mit einer Modulleistung von 2 kWp verwendet. Für die Berechnungen mit einem Batteriespeicher wird eine Kapazität von 2 kWh simuliert. Fertige Komplettpakete bietet beispielsweise Zendure an. Die PV-Module sind mit einem Winkel von 30° von der Balkonbrüstung gerechnet (also 60° geneigt), angebracht und nach Süd-Ost ausgerichtet. Dabei werden eine Variante nur mit einem Balkonkraftwerk ohne Batteriespeicher, eine mit einer optimierten Wärmebereitung mit überschüssigem Strom vom Balkonkraftwerk, eine Variante mit Batteriespeicher und eine komplett kombinierte Variante (mit Wärmebereitung und Batteriespeicher) gerechnet. Die Wärmebereitung erfolgt dabei mit dem stufenlosen Photovoltaik Power-Manager AC•THOR, der die Verwendung der überschüssigen Energie aus dem Balkonkraftwerk gezielt für die Warmwasserbereitung regelt.
Warum diese Anlagengröße ausgewählt wurde
Balkonkraftwerke werden fälschlicherweise immer in der Kategorie der Modulleistung bis 800 W, manchmal bis 1.200 W angenommen. Jedoch ergibt eine Anfrage im Markstammdatenregister folgendes Bild, wodurch diese Anlagengröße angenommen wurde. Die Daten stammen von einer Anfrage am 30. Juli 2025. Von den insgesamt 1.056.938 in Deutschland installierten und registrierten Balkonkraftwerken haben immerhin mehr als die Hälfte, genau 548.128 Balkonkraftwerke, eine installierte Modulleistung zwischen 801 bis 2.000 W. Die maximale Ausbeute an einem Balkonkraftwerk ist mit 2 kWp Modulleistung und 800 W Ausgangsleistung am Wechselrichter zu erreichen. Immerhin 61.921 Balkonkraftwerke mit genau 2.000 Watt gibt es mit Ende Juli 2025 in Deutschland. Tendenziell werden die Anlagen auch immer größer, da die PV-Module fast nichts mehr kosten, im Vergleich zu den restlichen Komponenten.
Szenario 1: Reine Nutzung der PV-Energie des Balkonkraftwerks ohne Batteriespeicher
Hier werden Photovoltaikmodule mit 2 kWp und einem 800 W Wechselrichter ohne Batteriespeicher simuliert. Der jährliche Ertrag des Balkonkraftwerks liegt bei 1.719 kWh. Die Auswertung zeigt deutlich, dass im 2-Personen-Haushalt von den 1.719 kWh Sonnenenergie ganze 1.031 kWh ungenutzt bleiben und ohne Kostenvorteil für den Balkonkraftwerksbesitzer in das öffentliche Netz eingespeist werden. In dieser Variante werden die erzeugten 688 kWh des Balkonkraftwerks direkt im Haushalt, unter anderem auch für die zufällige elektrische Wärmebereitung, genutzt. Diese niedrige Eigenverbrauchsquote liegt an der Ausrichtung der Anlage und der beruflichen Abwesenheit während der Hauptproduktionszeiten. Aufs Jahr gesehen spart man also nur 688 kWh Netzstrom und verschenkt 1.031 kWh an den Netzbetreiber.
Ein schönes Zubrot für die Stromanbieter, wir reden von immerhin über 1 Million Balkonkraftwerken in Deutschland, für den Verbraucher eher weniger vorteilhaft (Stand Juli 2025)!
| Energieproduktion AC | 1.719 kWh / Jahr |
| Netzeinspeisung | 1.031 kWh / Jahr |
| Netzbezug | 3.725 kWh / Jahr |
| Direktverbrauch des Heizstabs vom Balkonkrafterk | 158 kWh / Jahr |
| Solarer Deckungsgrad des Warmwasserbedarfs | 7 % |
Tabelle 1: Balkonkraftwerk mit 2 kWp, ohne Batteriespeicher, mit zufälliger Warmwasserbereitung
Szenario 2: Überschüsse des Balkonkraftwerks für die Wärmebereitung nutzen
In der zweiten Variante wird das Balkonkraftwerk mit einem stufenlos regelbaren Leistungssteller, der den Überschuss von einem Zähler am Netzeinspeisepunkt ausliest, gerechnet. Durch die Überschussmessung kann sehr viel Energie über einen Heizstab an den Warmwasserspeicher übergeben werden – selbst beim Balkonkraftwerk. Dadurch kann man den solaren Deckungsgrad des Warmwassers erhöhen und die erzeugte Energie des Balkonkraftwerks effizient nutzen. Eine Lösung bietet hier der EcoTracker von everHome. Dieser Strommesser darf vom Endkunden selbst, ohne Zuhilfenahme einer Fachkraft, installiert werden, da er einfach auf den bestehenden Zähler aufgesetzt wird und damit nicht ins Stromsystem eingreifen muss. Ein stufenlos regelbarer Photovoltaik Power-Manager von my-PV etwa, genannt AC•THOR, kann so den 3 kW Heizstab im Warmwasserspeicher stufenlos zur Wärmebereitung regeln. Übers Jahr gesehen werden somit 972 kWh für die Warmwasserbereitung aus dem Balkonkraftwerk verwendet. Heißt in Zahlen weiter, dass fast 43 % des Jahreswarmwasserbedarfs für den 2-Personen-Haushalt aus der normalerweise überschüssigen Energie eines 2 kWp Balkonkraftwerks gedeckt werden können.
Überdies werden nur mehr gut 165 kWh im Jahr (!) in das öffentliche Netz eingespeist. Das ist um etwa 84 % weniger, im Gegensatz zu der Variante ohne stufenlose Regelung, die gratis ins Netz gespeist wird. Der Netzbezug für die Haushaltsverbraucher, wie Elektrogeräte und Beleuchtung, bleibt genau gleich, wie wenn der Wärmebereich nicht verwendet werden würde; heißt, es entstehen im Alltagsbetrieb keine Mehrkosten, im Gegenteil. Die Lösungen von my-PV verwenden nur den überschüssigen Photovoltaikstrom, hier aus dem Balkonkraftwerk. Eine Erhöhung des Eigenverbrauchs und der Autarkie ist also ganz einfach umzusetzen!
| Energieproduktion AC | 1.719 kWh / Jahr |
| Netzeinspeisung | 165 kWh / Jahr |
| Netzbezug | 2.624 kWh / Jahr |
| Direktverbrauch des Heizstabs vom Balkonkrafterk | 972 kWh / Jahr |
| Solarer Deckungsgrad des Warmwasserbedarfs | 47 % |
Tabelle 2: Balkonkraftwerk mit 2 kWp, ohne Batteriespeicher, mit stufenlos geregelter Warmwasserbereitung
Szenario 3: Balkonkraftwerk in Verwendung mit einem Batteriespeicher
Fast schon obligatorisch für viele Betreiber eines Balkonkraftwerks ist die Nutzung eines Batteriespeichers - in unterschiedlichen Größen. Je weniger eigens erzeugter PV-Strom an den Betreiber verschenkt werden muss, desto besser das Gefühl des Balkonkraftwerkbesitzers. So lässt sich die Netzeinspeisung verringern und die erzeugte Energie speichern. Mit einem Batteriespeicher kann die produzierte Energie auch zu den Tageszeiten genutzt werden, zu denen kein Ertrag mehr aus dem Balkonkraftwerk zur Verfügung steht. Die Variante mit einem Batteriespeicher, aber ohne geregelter Wärmebereitung ist folgend berechnet.
Für die Berechnung wurde nun ein 2 kWh Batteriespeicher ergänzt bei gleicher Modulleistung von 2 kWp, allerdings im ersten Schritt mit dem Wegfall der stufenlosen Regelung für die Warmwasserbereitung. Selbst mit einem Batteriespeicher, der gleich groß ist wie die Leistung der PV-Module, werden noch 287 kWh kostenlos ins Netz eingespeist – also 122 kWh mehr als bei der stufenlosen Warmwasserbereitung, ohne Batteriespeicher – hier waren es 165 kWh.
Dies ist ein wesentlich besseres Ergebnis als die 1.031 kWh ohne Batteriespeicher, dennoch werden hier noch 287 kWh sprichwörtlich verschenkt.
Im Vergleich zur vorhergehenden Variante (ohne Batteriespeicher, dafür mit Warmwasserbereitung) hat der 3 kW Heizstab mit dem AC•THOR einen Netzbezug von 2.624 kWh. Hier zum Vergleich nur mit dem Batteriespeicher sind 2.981 kWh vom Netz zu beziehen. Dadurch wird deutlich, dass im Warmwasser mehr Energie gespeichert werden kann als im Batteriespeicher!
| Energieproduktion AC | 1.719 kWh / Jahr |
| Netzeinspeisung | 287 kWh / Jahr |
| Netzbezug | 2.981 kWh / Jahr |
| Direktverbrauch des Heizstabs vom Balkonkrafterk | 185 kWh / Jahr |
| Solarer Deckungsgrad des Warmwasserbedarfs | 7 % |
Tabelle 3: Balkonkraftwerk mit 2 kWp, 800 W Wechselrichter mit 2 kWh Batteriespeicher, ohne stufenlose Regelung der Warmwasserbereitung
Szenario 4: Balkonkraftwerk in Verwendung mit einem Batteriespeicher und Warmwasserbereitung
Nun aber noch die Kombination aus Balkonkraftwerk, Batteriespeicher und einer stufenlos geregelten Warmwasserbereitung. Für die mit Sicherheit- von den Anfangsinvestitionen mit Batteriespeicher und dem finanziellen Mehraufwand für die Warmwasserbereitung mittels PV-Strom –kostenintensivste Variante ergeben sich folgende Ergebnisse. Der Batteriespeicher wird geladen und deckt einen Teil des Stromverbrauchs im Haushalt, erst danach wird Überschuss in die Warmwasserbereitung gelenkt. So werden nur noch 11 kWh pro Jahr an den Energieversorger verschenkt – das sind im Vergleich zu Szenario 1 (einem herkömmlichen Balkonkraftwerk) nur mehr 1 %.
Mit dieser Konstellation kann der Balkonkraftwerksbesitzer somit 39 % des Eigenstromverbrauchs und zusätzlich 43 % des Warmwasserbedarfs pro Jahr decken.
| Energieproduktion AC | 1.719 kWh / Jahr |
| Netzeinspeisung | 11 kWh / Jahr |
| Netzbezug | 2.499 kWh / Jahr |
| Direktverbrauch des Heizstabs vom Balkonkrafterk | 879 kWh / Jahr |
| Solarer Deckungsgrad des Warmwasserbedarfs | 43 % |
Tabelle 4: Balkonkraftwerk mit 2 kWp, 800 W Wechselrichter mit 2 kWh Batteriespeicher
Das Maximum aus dem Balkonkraftwerk schafft man nur mit der Wärmebereitung!
Eine stufenlose Regelung, wie der AC•THOR sie bietet, kann das Maximum an überschüssiger Leistung des Balkonkraftwerks zur Warmwassererzeugung nutzen und somit den Eigenverbrauch massiv erhöhen. Ein Batteriespeicher kann ebenfalls dazu beitragen, die überschüssige Energie zu speichern und zu nutzen, wenn sie benötigt wird. Die Kombination von Batteriespeicher und stufenloser Regelung zur Warmwassererzeugung steigert die Effizienz weiter, hier werden nur noch 11 kWh in der Simulation an den Netzanbieter verschenkt, gleichzeitig werden bemerkenswerte Deckungsgrade in der Warmwasserbereitung sowie in der eigenen Stromversorgung erreicht – also dem eigentlichen Ziel eines Balkonkraftwerks.
Balkonkraftwerke bieten viele Vorteile – mit der stufenlosen Wärmebereitung holen Besitzer das Maximum aus ihrem eigenen Balkonkraftwerk heraus.